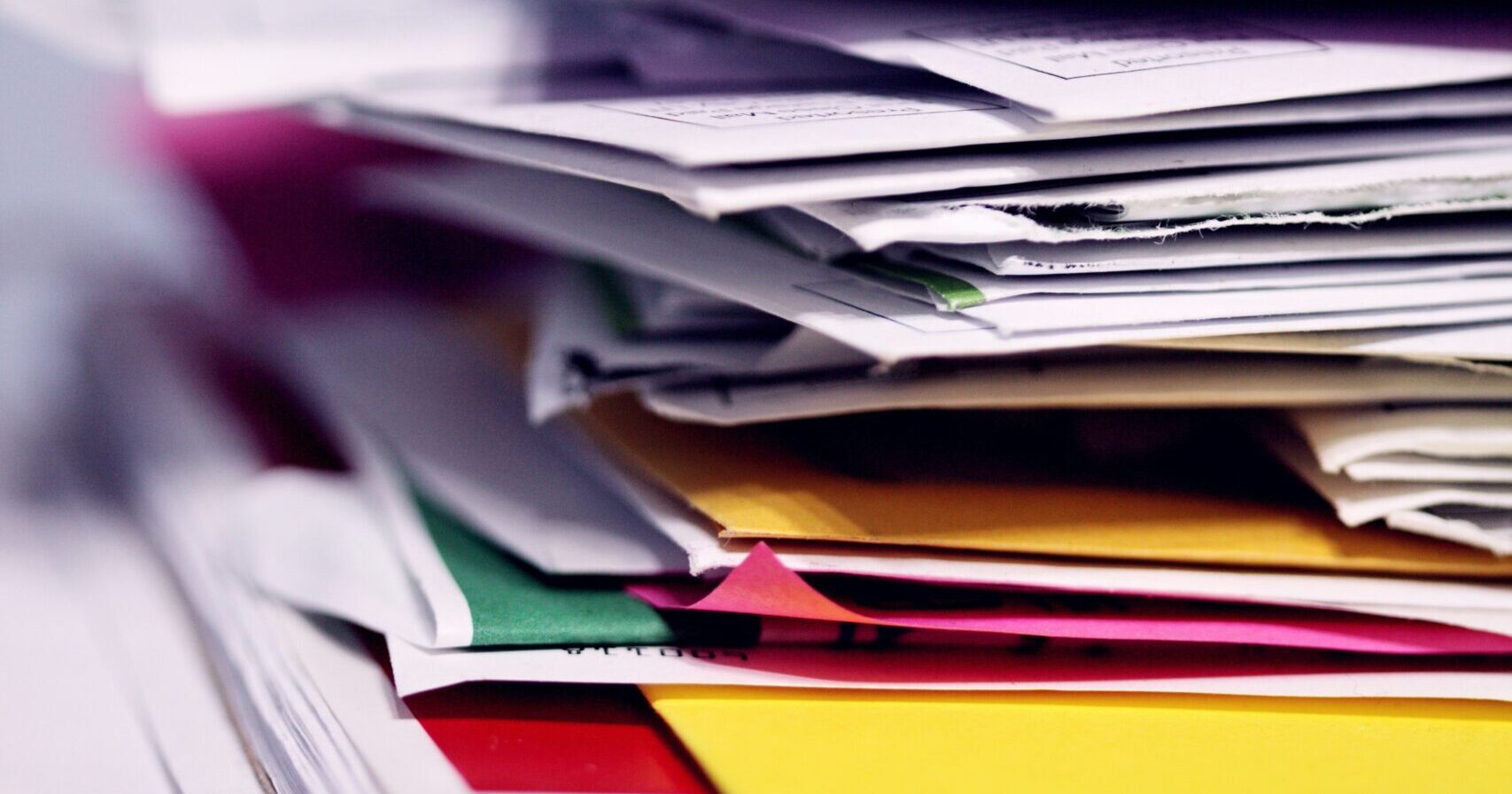Wenn Digitalisierung stecken bleibt
Digitalisierung am Bau ist längst kein Zukunftsthema mehr – sie ist Gegenwart. Und doch: Während Roboter vermessen, KI Prozesse analysiert und Dashboards vor Echtzeitdaten strotzen könnten, läuft auf vielen Baustellen noch alles wie eh und je. Warum eigentlich?

Wer wirklich mit den Leuten spricht, merkt schnell: Das Bild vom technologiefeindlichen Bauarbeiter ist falsch. Auf Baustellen und im Zuge seiner Lehrtätigkeit beim Bohrmeisterkurs der VÖBU trifft Philipp Maroschek regelmäßig auf eben dieses „gewerbliche Personal“, das an vorderster Front arbeitet – und es zeigt sich: Interesse und Motivation sind da. Das Problem liegt woanders.
Die naheliegende Erklärung: Es liegt am Personal.
„Die wollen einfach nicht!“ – so hört man oft, wenn Digitalisierungsvorhaben ins Stocken geraten. Schnell ist das gewerbliche Personal an vorderster Front der Buhmann: zu bequem, zu alt, zu stur oder schlicht nicht technikaffin genug. Doch wenn man genauer hinsieht, zeigt sich ein ganz anderes Bild. Eines, das viel komplexer ist – und viel menschlicher.
„Die Bohrmeister bzw. angehenden Bohrmeister zeigen durchaus Interesse am Thema Digitalisierung. Es beschäftigt sie – wie uns alle – und sie sind auch bereit auf der Baustelle zu digitalisieren. Im Vordergrund unseres Seminar-Nachmittags stehen Möglichkeiten und Herausforderungen der Digitalisierung. Besonders spannend, dass es oftmals an zwischenmenschlichen Problemen scheitert und nicht an der Technologie. Der Umgang miteinander und vor allem auch die Wertschätzung spielen hier eine wichtige Rolle. Die ein oder andere Geschichte hat mich auch persönlich getroffen, besonders weil Technologien hier oft missbraucht werden, oder nicht so genutzt werden, wie sie es sollten.“
Philipp Maroschek / Geschäftsführer eguana

Kein Tunnelblick in Zukunftsfragen
Zusätzlich zum Austausch mit den Teilnehmern im Bohrmeisterkurs hat Philipp im Rahmen der VÖBU-Reihe „Junge Talente im Spezialtiefbau“ unterschiedliche Perspektiven gesammelt – von Nachwuchstalenten bis zu den Größen der Branche.
„Es erweitert die Möglichkeiten, baubetriebliche Aspekte präzise abzubilden, auszuwerten, zu protokollieren und für die Abrechnung optimal aufzubereiten. Diese Funktion ermöglicht es uns, nicht nur die Effizienz unserer Abläufe zu steigern, sondern auch eine transparente und nachvollziehbare Dokumentation zu gewährleisten.“
Philipp Maroschek
Der Spezialtiefbau ist keine Fertigungsstraße
Digitalisierung funktioniert in vielen Industrien, weil Abläufe gleichbleibend sind. In der Automobilbranche oder der Elektronikproduktion ist das Umfeld kontrollierbar, standardisierbar, skalierbar. Nicht so am Bau.
Eine Spezialtiefbau-Baustelle ist ein hochkomplexes, dynamisches System: unvorhersehbare Geologie, Wetterumschwünge, wechselnde Teams, enge Zeitpläne und hohe Sicherheitsanforderungen. Digitalisierung ist hier nicht Plug & Play. Sie ist ein Werkzeugkasten, der mit Fingerspitzengefühl und Kontextverständnis eingesetzt werden muss.

Zwischen WLAN und Wertschätzung
Oft werden Digitalisierungsprojekte voller Begeisterung und Motivation gestartet – um nach kurzer Laufzeit festzustellen, dass sie einfach nicht die Ergebnisse bringen, die man sich eigentlich gewünscht hat.
Denn was bringt ein leistungsfähiges Datenmanagement-System, wenn einfach keine Daten drin sind?
Und tatsächlich, es ist das ausführende Personal, mit dem die Eingabe und Qualität der Daten steht und fällt. Es liegt aber meist nicht an deren Fähigkeiten und Kompetenz, dass Projekte scheitern. Die Ursache ist zugleich simpel, als auch komplex.
Die gute Nachricht aber lautet: das Problem ist lösbar. Aber schauen wir uns erst drei Beispiele an, wie man es nicht machen sollte. Wie ein Best-Practice aussieht, liegt dann eigentlich eh schon auf der Hand.

1. Das gemütliche Baubüro
Endlich wird digitalisiert. Der Bauleiter freut sich, denn im klimatisierten Container, hat er den Überblick über alle Maschinen und KPIs. Sieht er im System Abweichungen, erreicht er sein Team einfach über Funk und Telefon. Super effizient!
Doch auf der anderen Seite: Die Mannschaft draußen fühlt sich zunehmend kontrolliert statt unterstützt. „Die überwachen uns die ganze Zeit“, hört man. „Und wenn die Maschine mal steht, ruft er sofort an und fragt, warum – er macht sich nicht mal die Mühe aufs Baufeld rauszukommen und sich selbst ein Bild zu machen, der feine Herr.“ Die Folge: Frust.
„Der fragt mich ernsthaft, warum ich so wenige Meter mache, hat aber keinen Plan von der Arbeit, was ich hier leiste.“
Digitalisierung wird so zum Synonym für Kontrolle, nicht für Hilfe.
Der menschliche Kontakt geht verloren. Vertrauen wird durch Kontrolle ersetzt – und das sorgt für Frust. Manchmal sogar für Widerstand: Da hängt die Jacke plötzlich so unglücklich über der Kamera, dass sie nichts mehr sieht. Oder das WLAN funktioniert „leider nicht“, weil der Helm genau auf der Antenne liegt oder das Kabel des Routers rausgefallen ist. Nicht aus Bosheit, sondern aus Enttäuschung über ein System, das mich unsichtbar macht.
Digitalisierung kann Verbindung schaffen – oder sie kappen. Entscheidend ist, wie man’s angeht. Vor allem sollten wir die Menschen – unsere Kollegen – in den Vordergrund stellen. Moderne Technologien sollten dazu genutzt werden, mehr Zeit für den Austausch mit den Kollegen und das Miteinander zu schaffen und nicht weniger.
2. Das unfähige Personal
Das neue System da, das Dashboard eingerichtet – aber irgendwie bleibt alles leer. Keine aktuellen Maschinendaten, keine neuen Protokolle. Der Bauleiter klickt sich enttäuscht durch die Oberfläche. „War ja klar“, murmelt er, „die können halt mit sowas nicht umgehen.“
Auf der anderen Seite der Baustelle steht der Maschinenführer. Er schaut auf das neue Tablet, mit dem er ab jetzt arbeiten soll. Was, wenn er was falsch macht? Lieber lassen. Sicherheitshalber. Ich will ja dann nicht blöd dastehen! Aus Unsicherheit wird Zurückhaltung – aus Zurückhaltung wird Frust.

Fehlerhafte oder fehlende Eingaben sind selten Trotz, viel öfter Ratlosigkeit. Auf Systeme, die niemand erklärt. Auf Prozesse, die keinen Sinn ergeben. Und auf Vorgesetzte, die nie fragen, ob alles klar ist. Wer nicht weiß, warum eine Maßnahme wichtig ist, und wie sie funktioniert, macht sie auch nicht motiviert.
Digitalisierung ist keine Einbahnstraße. Es braucht Schulung, Training, Austausch – und vor allem Wertschätzung.
„Wer Digitalisierung wirklich will, muss auch bereit sein, zu investieren: nicht nur monetär in Tablets, WLAN und Software – sondern vor allem in Zeit durch Kommunikation, Erklärung und Unterstützung. Auf Augenhöhe. Es handelt sich um eine Veränderung von bestehenden, gelebten Prozessen. Um diesen Wandel erfolgreich zu vollziehen, müssen alle an einem Strang ziehen. Es bedarf Teamwork.“
Philipp Maroschek

3. Ich bin der Chef
Ein kurzer Besuch auf der Baustelle. Der Chef schaut vorbei, nickt in die Runde und verkündet stolz: „Wir arbeiten jetzt endlich auch digital und haben da in ein tolles neues System investiert. Ab heute bitte auch alles digital dokumentieren – ist total einfach, selbsterklärend.“ Danach steigt er wieder ins Auto. Sicherheitshalber muss aber trotzdem weiter auf Papier mitgeschrieben werden. Man weiß ja nie.
Im Büro ist man überzeugt, dass das neue System läuft – schließlich hat man ja viel investiert. Und wer eine Frage hat, kann ja nachlesen. Oder sich durchklicken. Oder einfach selbst draufkommen.
Das Problem: Niemand will der Erste sein, der sich blamiert. Wenn’s keine Einschulung gibt, keine Ansprechpartner*innen, keine Zeit zum Ausprobieren – dann macht man halt lieber gar nichts. Fehler kann man vermeiden, indem man nichts riskiert. Und sobald das System doppelt läuft – digital und analog – ist klar, was gewinnt: der bewährte Zettel.
Das ist kein böser Wille. Es ist Unsicherheit. Wer Digitalisierung wirklich will, muss Vertrauen schaffen. Und das beginnt bei der Führungsebene. Wer mit neuen Tools arbeitet, braucht Erklärungen, Rückhalt und das Gefühl, dass es okay ist, Fragen zu stellen.
Solange die Führungsebene Digitalisierung als reine Tool-Frage behandelt, bleibt der Mensch außen vor. Dabei geht es genau um ihn. Um das Verständnis. Um den Zweck. Um das Vertrauen, dass es okay ist, Fehler zu machen – solange man gemeinsam dazulernt.
„Man muss dem Personal auch erklären, warum man digitalisiert. Was man sich davon erwartet. Wo für das Unternehmen und die Mitarbeiter der Nutzen liegt und warum es wichtig ist. Die Leute müssen abgeholt werden und man muss sie aktiv in die Gestaltung der digitalen Systeme einbinden und sie diese Systemlandschaft auch mitgestalten lassen.“
Philipp Maroschek
Digitalisierung ist keinesfalls ein Selbstläufer – sondern ein gemeinsamer Weg. Und der beginnt nicht mit einem System-Update, sondern mit einem Gespräch.
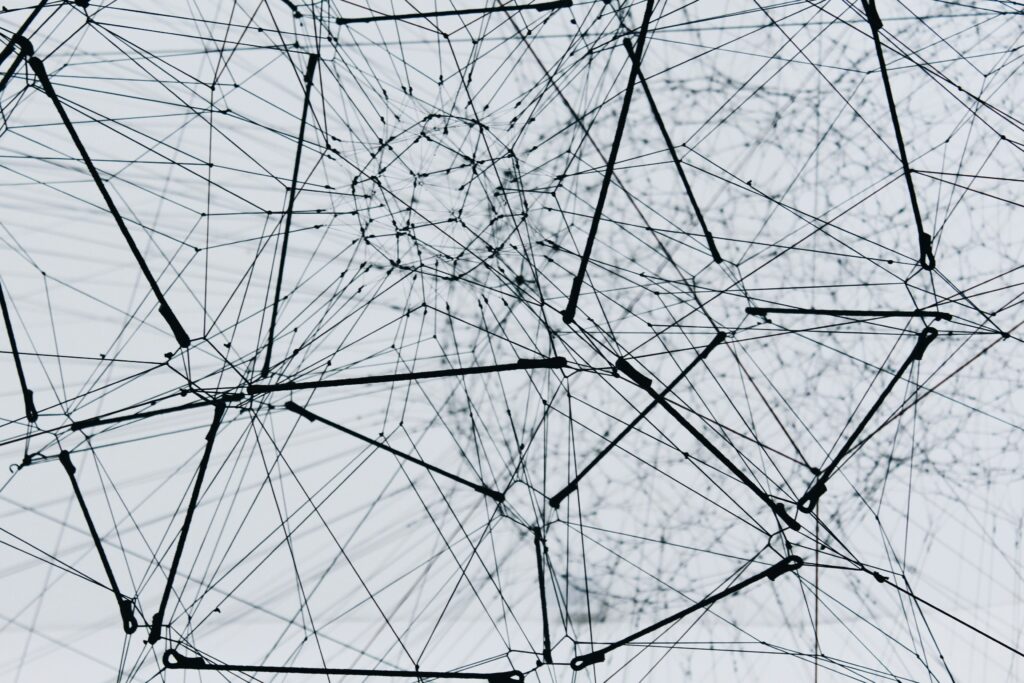
Lösung: Verbindung statt Verurteilung
Was es braucht, ist nicht mehr Technik – sondern mehr Verbindung.
„Wir brauchen nicht mehr Digitalisierung oder mehr Daten, wir brauchen mehr Verbindung. Digitale Tools müssen uns dabei helfen mehr Zeit fürs Wesentliche zu finden, die Zusammenarbeit, das Mitaneinander auf der Baustelle. Sie dürfen uns nicht behindern und uns auch nicht mehr Arbeit machen, sondern sie müssen uns frei schaufeln.“
Wenn dein Team den Eindruck hat, dass du sowieso nur im klimatisierten Büro sitzt und dann per Funk durchgibst, was sie bitte schneller, sauberer oder anders machen sollen, wird es schwer, Vertrauen aufzubauen. Aber was dein Team oft nicht sieht: wie viel Zeit du regelmäßig damit verbringst, fehlende Daten nachzutragen, falsche Eingaben zu korrigieren oder fünf verschiedenen Tabellen nachzupflegen, weil wieder mal nichts zusammenpasst.

Stell dir vor, du hättest genau diese Zeit zurück. Nicht, weil du weniger machst – sondern weil dein Team dich durch verlässliche, gut dokumentierte Datenarbeit unterstützt, ein digitales System zu befüllen. Das bedeutet: weniger Stress, weniger Chaos, weniger Nacharbeit. Und dafür mehr Luft, um dich um das zu kümmern, was wirklich zählt – die Menschen auf deiner Baustelle. Die, die bei +30 °C am Baufeld stehen oder nachts bei Regen die Grube abdichten.
Kurz gesagt: Dein Team kann dir mit digitalen Prozessen Zeit freischaufeln. Und du kannst diese Zeit nutzen, um genau diesem Team wieder mehr zurückzugeben.
Damit das funktioniert, gibt es einen einfachen Leitsatz: Respekt ist nicht optional.
Wer Digital Leadership ernst meint, muss auch analog gut führen können. Geh hin. Schau dir an, wie die Arbeit aussieht. Lern dein Team kennen. Begrüße die Leute. Mit Handschlag. Mit Wertschätzung. Mit echtem Interesse. Eine kurze Frage, wie es den Kindern geht. Wasser vorbeibringen, wenn es heiß ist. Ein „Danke, dass du deine Arbeit so sorgfältig machst„. Kleine Gesten, große Wirkung.
Digitalisierung, die keiner will, bringt nichts
Technologie kann ein Werkzeug für mehr Produktivität, bessere Qualität und echte Entlastung sein. Aber nur, wenn man die Menschen mitnimmt. Wenn man erklärt, wie sie davon profitieren. Und wenn man ihnen zuhört, wenn sie sagen, was nicht funktioniert.
Denn Digitalisierung kann helfen, die Baustelle effizienter zu machen. Aber sie kann auch helfen, sie menschlicher zu machen. Wenn wir bereit sind, beides zu wollen.